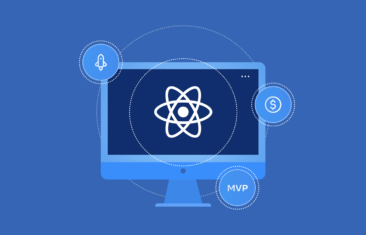Was ist Cloud Migration?
Schlüsselfakten
- Cloud-Migration ist der strukturierte Transfer von Anwendungen, Daten und Workloads aus On-Premises-Umgebungen in die Cloud.
- Es gibt verschiedene Ansätze wie vollständige Migration, hybride Modelle oder Cloud-to-Cloud-Wechsel.
- Unternehmen wählen zwischen IaaS, PaaS und SaaS, abhängig von gewünschter Kontrolle und Verantwortlichkeit.
- Zentrale Vorteile sind Kosteneffizienz, Skalierbarkeit, höhere Sicherheit und integrierte Backup-Mechanismen.
- SaM Solutions unterstützt Unternehmen mit End-to-End-Services – von Beratung über Umsetzung bis hin zu Betrieb und Support.
Was ist Cloud-Migration, welche Arten es gibt, warum sie notwendig ist, welche Vorteile sie bietet und wo Unternehmen, die mit der Cloud-Transformation beginnen, auf Herausforderungen stoßen können. SaM Solutions beschreibt die Migrationsphasen im Detail und gibt eine Übersicht über die beliebtesten Plattformen.
Definition der Cloud-Migration
Unter Cloud-Migration versteht man den Prozess des Verschiebens von Anwendungen, Daten und IT-Workloads von einem bisherigen Standort – meist einem lokalen Rechenzentrum – in eine Cloud-Umgebung. Cloud-Migration ist kein einmaliger „Umzug“, sondern ein komplexer Prozess mit mehreren Phasen. Er umfasst die strategische Planung, Auswahl geeigneter Dienste und das eigentliche Überführen der Rechenressourcen in die neue Umgebung. Eine erfolgreiche Cloud-Migration setzt daher sorgfältige Planung und oftmals externe Expertise voraus, um Risiken wie Ausfallzeiten oder Inkompatibilitäten zu minimieren.
Machen Sie den nächsten Schritt in der digitalen Transformation mit innovativen Cloud-Services von SaM Solutions.
Wichtige Aspekte der Cloud-Migration
Eine Cloud-Migration berührt viele Bereiche der IT. IT-Entscheider sollten insbesondere auf folgende Schlüsselaspekte achten, um den Übergang in die Cloud effizient und risikoarm zu gestalten.
Kostenanalyse und ROI
Dabei gilt es, alle Kosten der Migration den erwarteten Einsparungen und Nutzen gegenüberzustellen. Einerseits entfallen bei der Cloud viele Kapitalinvestitionen in Hardware – Unternehmen zahlen im Pay-as-you-go-Modell nur für tatsächlich genutzte Ressourcen, was enorme Kosteneinsparungen ermöglicht. Andererseits dürfen Migrationskosten nicht unterschätzt werden. Wichtig ist, den Return on Investment (ROI) der Cloud-Migration zu bewerten: Eine Forrester-Studie zeigte z.B. eine Investitionsrendite von 191 % innerhalb von drei Jahren nach der Cloud-Migration. Allerdings warnt die Praxis, dass schlechte Planung oder unvorhergesehene Nutzung die Cloud-Rechnung in die Höhe treiben können.

Datenintegrität und -sicherheit
Im Migrationsprozess müssen Daten zuverlässig und vollständig übertragen werden – Datenverlust oder Inkonsistenzen können gravierende Folgen für das Tagesgeschäft haben. Gleichzeitig dürfen sensible Daten während der Übertragung oder im Cloud-Betrieb nicht in falsche Hände geraten. Best Practices umfassen daher u.a. Datenverschlüsselung, den Einsatz von robustem Identity und Access Management (IAM) sowie regelmäßige Sicherheitsaudits.
Kompatibilität der Anwendungen
Häufig erfolgt mit der Cloud-Migration ein Plattformwechsel, und die neuen Cloud-Services sind nicht 1:1 kompatibel mit den bisherigen Systemen. Daher ist es unabdingbar, vorab die Kompatibilität zu prüfen. In vielen Fällen müssen Anwendungen angepasst oder neu gestaltet werden, um in der Cloud voll funktional zu sein.
Performance und Latenz
Kunden und Mitarbeiter erwarten, dass Anwendungen in der Cloud mindestens die gleiche Leistung erbringen wie bisher vor Ort – idealerweise sogar besser. Performance-Engpässe oder hohe Latenzzeiten nach einer Migration können jedoch auftreten, wenn Netzwerkanbindungen oder Architekturen nicht angepasst werden. Bei einer global verteilten Nutzerbasis kann es sinnvoll sein, Workloads näher an den Endbenutzern auszuführen, um die Latenz zu reduzieren. Eine sorgfältige Performance-Planung ist ein Teil jeder Migration – sie stellt sicher, dass hohe Verfügbarkeit und schnelle Reaktionszeiten auch in der Cloud gewährleistet bleiben.
Arten der Cloud-Migration
Die Art der Cloud-Migration beschreibt grob, was migriert wird und wohin es verschoben wird.
Rechenzentrumsmigration
Eine Rechenzentrumsmigration meint die vollständige Verlagerung eines lokalen Rechenzentrums in die Cloud. Hierbei werden alle Daten, Anwendungen und Services eines Unternehmens von eigenen Servern auf die Infrastruktur eines Cloud-Providers übertragen. Diese “All-in” Migration ist ein sehr umfangreiches Projekt und erfordert gründliche Planung und Tests, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten.
Hybrid-Cloud-Migration
Bei der Hybrid-Cloud-Migration entscheidet sich ein Unternehmen bewusst dafür, nur einen Teil seiner Ressourcen in die Cloud zu verlagern, während andere Teile im eigenen Rechenzentrum verbleiben. Das Ergebnis ist eine Hybrid-Cloud-Umgebung, die lokale Infrastruktur mit Cloud-Services kombiniert. Dies hat mehrere Vorteile: Unternehmen können weiterhin Wert aus bestehenden Investitionen in On-Premises-Infrastruktur schöpfen und gleichzeitig die Flexibilität und Skalierbarkeit der Public Cloud für ausgewählte Workloads nutzen.
Cloud-zu-Cloud-Migration
Bei einer Cloud-zu-Cloud-Migration werden Workloads, Anwendungen oder Daten von einem Cloud-Anbieter zu einem anderen übertragen. Gründe können sein: Kostenoptimierung, technologische Vorteile oder Geschäftsentwicklungen. Wichtig ist, mögliche Downtimes während der Umschaltung zu minimieren, etwa durch synchrone Datenreplikation und gründliche Tests vor dem endgültigen Switch.
Anwendungs- und Datenbankmigration
Statt gleich ein ganzes Rechenzentrum zu verlagern, wählen viele Unternehmen einen Workload-spezifischen Ansatz: Die Migration einzelner Anwendungen, Datenbanken oder sogar Mainframe-Systeme in die Cloud. Ziel ist es, für diese spezifischen Komponenten die Vorteile der Cloud zu realisieren – zum Beispiel geringere Kosten, zuverlässigere Leistung und höhere Sicherheit für eine bestimmte Datenbank.
Cloud-Servicemodelle
Ein wichtiger Kontext der Cloud-Migration sind die Cloud-Servicemodelle. Sie beschreiben, auf welcher Ebene ein Cloud-Anbieter Dienste bereitstellt und welche Verantwortlichkeiten beim Provider bzw. beim Nutzer liegen. Man unterscheidet in der Regel drei Hauptmodelle: IaaS, PaaS und SaaS. Bei einer Migration muss entschieden werden, auf welcher Ebene die Zielumgebung angesiedelt sein soll.
Infrastructure as a Service (IaaS)
Bei IaaS mietet das Unternehmen Rechenressourcen wie virtuelle Server, Speicher und Netzwerke von einem Cloud-Provider. Der Cloud-Anbieter stellt Infrastruktur-Hardware und Virtualisierung bereit; das Unternehmen installiert und verwaltet darauf seine eigenen Betriebssysteme, Anwendungen und Daten.
IaaS eliminiert die Kosten und Komplexität, die mit dem Kauf und Betrieb eigener Server und Rechenzentrums-Hardware
Platform as a Service (PaaS)
PaaS-Angebote bieten oft verwaltete Datenbanken, APIs, Business-Analytics-Services und Betriebssysteme out-of-the-box. Dies ermöglicht es, Entwicklungskosten zu senken und neue Anwendungen schneller bereitzustellen. Bei einer Migration kann PaaS attraktiv sein, wenn man bestehende Anwendungen mit vertretbarem Aufwand so anpassen kann, dass sie auf einer solchen Plattform laufen.
Beispielsweise könnten Sie Ihre On-Premise-Webanwendung auf Azure App Service oder AWS Elastic Beanstalk (beides PaaS-Dienste) migrieren, anstatt eigene VMs aufzusetzen.
Software as a Service (SaaS)
SaaS ist das am höchsten abstrahierte Modell: Hier stellt der Anbieter eine vollständige Anwendung als Dienst über das Internet bereit. Der Kunde nutzt die Software direkt im Browser oder via Client, ohne sich um Installation, Infrastruktur oder Updates zu kümmern. Beispiele sind E-Mail-Dienste, CRM-Systeme oder Kollaborationssoftware in der Cloud.
Vorteil: Schneller Zugang zu einer voll funktionsfähigen Lösung, ohne Migrationsaufwand der eigenen Software. Nachteil: Weniger Individualisierung und mögliche Abhängigkeit vom SaaS-Anbieter. Bei vielen modernen Softwareprojekten prüfen Unternehmen zunächst, ob es nicht ein SaaS-Angebot gibt, bevor sie in eigene Installationen investieren.
Phasen der Cloud-Migration
Eine Cloud-Migration erfolgt in mehreren Phasen, die jeweils unterschiedliche Aufgaben und Ziele haben. Je nach Größe des Projekts können diese Phasen kürzer oder länger ausfallen, aber grundsätzlich durchläuft jede Migration ähnliche Schritte.

Strategieentwicklung
In dieser Phase wird die geschäftliche Begründung für die Cloud-Migration definiert – Warum will das Unternehmen in die Cloud? Mögliche Treiber sind z.B. Kosteneinsparungen, schnelleres Time-to-Market, Skalierungsbedarf oder neue Technologiemöglichkeiten.
Laut IBM sollte der Business Case der Migration sauber formuliert werden, bevor man in die Umsetzung geht. Zudem entscheidet man in dieser Phase über den grundsätzlichen Scope: Vollmigration vs. Hybrid-Ansatz, Auswahl einer primären Cloud-Plattform, etc.
Bewertung und Planung
Zunächst wird die bestehende IT-Landschaft gründlich bewertet: Welche Anwendungen, Server, Datenbestände existieren? Welche Abhängigkeiten bestehen zwischen Systemen? Was ist migrationsgeeignet und was eventuell nicht?
Dabei entstehen Inventarlisten und Kategorien von Anwendungen. Ebenso werden Sicherheits- und Compliance-Anforderungen geprüft. In dieser Planungsphase werden zudem Migrationsziele je Anwendung definiert – beispielsweise welche Strategie (Rehosting, Refactoring etc.) für welches System angewendet wird. Ergebnis der Phase ist ein detaillierter Migrationsfahrplan, der alle Aufgaben, Verantwortlichkeiten (inkl. interne Teams oder Partner), den Zeitplan und ggf. ein Pilotvorhaben enthält.
Vorbereitung der Infrastruktur
Bevor die eigentliche Migration starten kann, müssen sowohl die Ausgangsumgebung als auch die Zielumgebung vorbereitet werden. Auf Seite der Cloud-Infrastruktur bedeutet das, die notwendigen Cloud-Ressourcen einzurichten: z.B. Ziel-Netzwerke, virtuelle Server (Platzhalter), Speicherplätze, Konten und Zugriffsberechtigungen. Oft wird ein Grundgerüst der Cloud-Architektur entworfen – etwa wie Anwendungen und Daten in der Cloud strukturiert werden sollen.
Wichtige Überlegungen sind hier: Netzwerk- und Sicherheitskonfigurationen in der Cloud Auswahl passender Cloud-Services und die Sicherstellung von Backup- und Disaster-Recovery-Mechanismen in der Cloud. Parallel dazu bereitet man die lokale Infrastruktur vor. Eine gute Vorbereitung minimiert nachfolgend Downtime und Fehlversuche.
Durchführung der Migration
Die ausgewählten Workloads werden in die Cloudumgebung verschoben. Je nach Migrationsstrategie läuft dieser Schritt unterschiedlich ab. Bei Rehosting (Lift & Shift) werden beispielsweise virtuelle Maschinen exportiert und in der Cloud importiert; bei Refactoring wird die Anwendung neu bereitgestellt und dann die Datenmigration durchgeführt.
In vielen Fällen beginnt man mit einer Pilot-Migration einer unkritischen Anwendung, um den Prozess zu verfeinern. Anschließend erfolgt die Migration schrittweise nach dem definierten Migrationsplan.
Optimierung und Wartung
Nach der Migration ist vor der Optimierung: Sobald die Systeme in der Cloud laufen, beginnt die Phase der Nachbesserung und des langfristigen Betriebs. Zunächst erfolgen umfangreiche Tests und Validierungen. Dazu gehören Funktionstests, Lasttests und Überprüfungen der Sicherheit. Eventuell entdeckte Probleme werden behoben. Anschließend verlagert sich der Fokus auf die Optimierung der Cloud-Ressourcen.
Diese Phase stellt sicher, dass die Cloud-Migration nicht nur technisch abgeschlossen, sondern auch geschäftlich erfolgreich ist – durch fortlaufende Optimierung werden die angestrebten Vorteile maximiert und der Betrieb stabilisiert.
Vorteile der Cloud-Migration
Eine durchdachte Cloud-Migration kann Unternehmen zahlreiche Vorteile bringen. Hier sind die wichtigsten Pluspunkte im Überblick.
Herausforderungen der Cloud-Migration
So groß die Vorteile der Cloud-Migration sind, sie gehen mit erheblichen Herausforderungen einher. Ein erfolgreicher Umzug erfordert, diese Stolpersteine zu kennen und aktiv anzugehen. Hier die häufigsten Problembereiche, mit denen Unternehmen konfrontiert werden.
Komplexität der Migration
Während das Verschieben einzelner Workloads relativ einfach sein kann, erfordert die Planung einer großflächigen Migration eine umfassende, unternehmensweite Abstimmung. Es müssen verschiedenste Teams (IT-Betrieb, Entwicklung, Security, Fachbereiche) koordiniert werden. Alte monolithische Strukturen der IT kommen ans Licht, und es gilt, Jahrzehnte gewachsene Systemlandschaften in Frage zu stellen. Viele unterschätzen den Aufwand der Vorbereitung und Planung – das Resultat können chaotische Migrationsversuche sein.
Sicherheitsrisiken
Obwohl die Cloud verbesserte Sicherheitsoptionen bietet, bringt die Migration auch neue Sicherheitsrisiken mit sich. Zum einen entstehen während der Migrationsphase Übergangszeiten, in denen Daten übertragen oder parallel gehalten werden – Angreifer könnten versuchen, genau diese Phasen auszunutzen, wenn das Sicherheitsniveau temporär schwächer ist. Zum anderen gilt in der Cloud das Shared-Responsibility-Modell: Cloud-Anbieter bieten eine Vielzahl von Sicherheits- und Compliance-Lösungen, aber der Kunde ist selbst dafür verantwortlich, die richtigen auszuwählen und korrekt zu implementieren.
Ein weiteres Risiko ist der menschliche Faktor – Administratoren und Entwickler müssen umdenken, da sich Security-Mechanismen in der Cloud teils unterscheiden
Downtime und Betriebsunterbrechungen
Betriebsunterbrechungen gehören zu den gefürchtetsten Problemen bei einer Migration. Selbst mit guter Planung lässt es sich nicht immer vermeiden, dass bestimmte Dienste während des Umzugs nicht verfügbar sind oder in reduzierter Performance laufen. Gerade bei Lift-and-Shift-Ansätzen, wo man eine Anwendung kurzfristig vom alten auf das neue System umschaltet, können Downtimes auftreten.
Ziel ist natürlich, diese Unterbrechungen so gering wie möglich zu halten. Cloud-Anbieter und Tools unterstützen hier mit verschiedenen Methoden: z.B. Live-Migrationen, sukzessive Replikation von Daten oder der Aufbau von Übergangslösungen. Dennoch erfordert es sorgfältige Planung, die richtige Zeitfenster für die Umschaltung zu wählen.
Schulungsbedarf
Die Einführung neuer Cloud-Technologien bringt einen erheblichen Schulungs- und Umstellungsbedarf für die IT-Mitarbeiter mit sich. Selbst erfahrene Systemadministratoren oder Entwickler müssen sich mit den Besonderheiten der Cloud-Plattform vertraut machen. Zwar lassen sich viele Kenntnisse auf die Cloud übertragen, dennoch sind Weiterbildungsmaßnahmen erforderlich. Die Investition in Ausbildung – sei es durch offizielle Zertifizierungen oder durch das Hinzuziehen erfahrener Berater als Mentoren – ist daher ein Muss.
Kostenkontrolle
Während die Cloud viele Kostenvorteile bietet, kann mangelhafte Planung oder unvorhergesehene Nutzung schnell zu höheren Kosten führen. Insgesamt erfordert die Kostenkontrolle in der Cloud neue Prozesse und Disziplin. Unternehmen, die anfangs euphorisch migrieren, erleben manchmal einen „Bill Shock“, wenn sie die erste umfassende Rechnung sehen. Mit vorausschauender Planung und fortlaufendem Kostenmanagement kann man die Finanzen aber im Griff behalten und die versprochenen Kostenvorteile der Cloud tatsächlich genießen.
Cloud-Migrationsstrategien
Es gibt verschiedene Strategien, wie ein Unternehmen seine Anwendungen in die Cloud bringen kann.

Rehosting (Lift-and-Shift)
Rehosting – besser bekannt als “Lift and Shift” – ist meist der schnellste und unkomplizierteste Ansatz. Dabei werden bestehende Anwendungen und Daten praktisch unverändert von On-Premises in die Cloud migriert. Man „hebt“ also z.B. eine virtuelle Maschine aus dem eigenen Rechenzentrum und „verschiebt“ sie in eine VM beim Cloud-Anbieter. Es sind keine wesentlichen Änderungen an der Architektur nötig.
Rehosting ermöglicht einen schnellen Einstieg in die Cloud und nutzt bestehende Investitionen in Software weiter. Allerdings schöpft diese Strategie die Cloud-Vorteile nicht vollständig aus – die Anwendung wurde ja nicht angepasst, um etwa Skalierungsfunktionen oder Cloud-Datenbanken optimal zu nutzen.
Replatforming
Bei Replatforming – manchmal als “Lift-and-Reshape” beschrieben – nimmt man die Anwendung ebenfalls in die Cloud, aber mit kleinen Optimierungen, um bestimmte Cloud-Vorteile zu nutzen. Es werden einige minimale Änderungen an der bestehenden IT-Architektur vorgenommen, um beispielsweise Cloud-Managed Services zu nutzen oder die Effizienz zu verbessern.
Refactoring
Refactoring – auch Re-Architecting genannt – geht am tiefsten: Hier wird die Anwendung grundlegend überarbeitet oder neu entwickelt, um voll von der Cloud zu profitieren. Man nutzt Cloud-optimierte Architekturmuster (z.B. Microservices, Serverless Computing, ereignisgesteuerte Systeme) und modernisiert die Software entsprechend.
Dieser Ansatz erfordert oft erhebliche Änderungen an der bestehenden Architektur, bringt aber die größten Vorteile in Bezug auf Skalierbarkeit, Ausfallsicherheit und Effizienz.
Repurchasing
Repurchasing ( auch „Rückkauf“) bedeutet, eine bestehende Anwendung nicht zu migrieren, sondern sie durch ein neues Cloud-basiertes Produkt zu ersetzen. Anstatt also Zeit und Aufwand zu investieren, eine alte Software in die Cloud zu bringen, entscheidet sich das Unternehmen, eine SaaS-Lösung oder eine komplett neue Anwendung zu nutzen, die die benötigten Funktionen liefert.
Ein typisches Beispiel: Statt ein altes on-Premise CRM-System in die Cloud zu heben, wechselt man zu Salesforce (SaaS); oder man ersetzt die lokale Telefonanlage durch einen Cloud-Service. Repurchasing ermöglicht den sofortigen Zugriff auf eine cloudbasierte Lösung, ohne dass ein umfangreiches Refactoring nötig wäre.
Retire and Retain
Dabei werden veraltete oder nicht mehr benötigte Anwendungen identifiziert und außer Betrieb genommen, statt sie zu migrieren. Im Laufe der Bewertung (siehe Phasen) stellt man oft fest, dass einige Systeme eigentlich keinen echten Nutzen mehr bringen. Durch Abschaltung dieser Altlasten spart man Kosten und bereinigt die IT-Landschaft.
Hierunter versteht man, bestimmte Anwendungen oder Komponenten vorerst in ihrer aktuellen Umgebung zu belassen und nicht in die Cloud zu migrieren. Dies kann verschiedene Gründe haben: Vielleicht ist eine Anwendung noch nicht cloud-ready, eine spezielle Maschine kann nicht einfach abgelöst werden, oder geschäftlich lohnt sich die Migration (noch) nicht.
Mit der Kombination von Retire & Retain schließen Unternehmen ihre Migrationsstrategie ab: Alles was migriert werden soll, hat einen Plan (Rehost/Replatform/Refactor/Repurchase), der Rest wird entweder stillgelegt oder verbleibt einstweilen wo es ist.
Tools und Plattformen für Cloud-Migration
Eine Cloud-Migration muss niemand allein „zu Fuß“ bewältigen – alle großen Anbieter stellen umfangreiche Tools und Plattformen bereit, um den Migrationsprozess zu unterstützen. Hier ein kurzer Überblick über die wichtigsten Migrations-Werkzeuge von AWS, Azure und Google Cloud.
Warum SaM Solutions für die Cloud-Migration wählen?
Die Wahl des richtigen Partners kann bei einer Cloud-Migration entscheidend sein – speziell, wenn im eigenen Haus Ressourcen oder Know-how begrenzt sind. SaM Solutions bietet sich hier als erfahrener Dienstleister an. Das Unternehmen ist ein internationaler IT-Service- und Software-Lösungsanbieter mit über 30 Jahren Erfahrung.
Mit dieser langjährigen Expertise hat SaM Solutions bereits zahlreiche Cloud-Projekte erfolgreich umgesetzt. Von der strategischen Beratung über die Planung bis hin zur technischen Umsetzung und Nachbetreuung deckt SaM Solutions alle Phasen der Cloud-Migration ab.
Ein spezialisiertes Team von Cloud-Architekten und Entwicklern – zertifiziert in AWS, Azure und Google Cloud – sorgt dafür, dass für jede Anwendung die optimale Migrationsstrategie gefunden wird.

Fazit
Die Cloud-Migration ist mehr als nur ein IT-Projekt – sie ist ein strategischer Schritt, um die Weichen für die digitale Zukunft zu stellen. Doch eine erfolgreiche Migration (die nur Vorteile der Cloud-Migration bringt) kommt nicht von selbst: Sie erfordert gründliche Vorbereitung, eine solide Strategie und das Meistern von Herausforderungen wie Sicherheit, Downtime-Minimierung und Kostenkontrolle. Unternehmen sollten sich die Zeit nehmen, wichtige Aspekte – von ROI-Planung bis Anwendungskompatibilität – im Vorfeld zu durchdenken.
Mit den richtigen Migrationsstrategien (ob Rehosting, Refactoring oder andere) lässt sich für jede Anwendung ein passender Weg finden, und eine Fülle von Tools der Cloud-Anbieter steht bereit, um den Prozess technisch zu erleichtern. Am Ende zahlt sich die Mühe aus: Die Cloud eröffnet Möglichkeiten zur Innovation, ermöglicht eine schnellere Bereitstellung von IT-Ressourcen und kann die IT-Kostenstruktur nachhaltig verbessern.